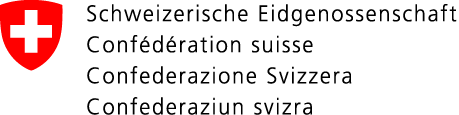Der Winterdienst gehört zum kontinuierlichen betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen, genauso wie die Pflege der Mittelstreifen, der Böschungen und der Betriebs- und Sicherheitsanlagen sowie die Reinigung von Entwässerungsleitungen, Rastplätzen und Unfallstellen.

Diese Arbeiten sollen die grösstmögliche Verkehrssicherheit auf den Strassen und deren optimale Nutzung gewährleisten. Der Winterdienst auf den Nationalstrassen ist ein gesetzlicher Auftrag, der in 18 Normen und Rechtstexten geregelt ist. Der Dienst gilt von Oktober bis April.
Seit dem 1.1.2008 ist für den Winterdienst auf den Nationalstrassen der Bund zuständig. Zur Wahrnehmung dieses Auftrags schliesst das Bundesamt für Strassen mit 11 Gebietseinheiten Leistungsvereinbarungen ab. Um die Beziehungen zu den Gebietseinheiten kümmern sich die 5 ASTRA-Filialen. Die Gebietseinheiten übernehmen den Dienst selbst oder beauftragen Privatunternehmen mit den entsprechenden Aufgaben.
50 Werkhöfe und Stützpunkte entlang der Nationalstrassen ermöglichen ein schnelles Eingreifen auf dem ganzen Strassennetz.
Auf Autobahnen gilt der höchste Leistungsstandard: die so genannte „Schwarzräumung", d.h. die komplette Entfernung des Schnees inklusive Massnahmen gegen Strassenglätte.
In der Regel muss der Winterdienst innerhalb von 2 Stunden nach der Mobilisierung eine erste Räumung vornehmen. Bei anhaltendem Schneefall ist ein zweiter Durchgang erforderlich.
Um einen schnellen Einsatz zu gewährleisten, ist ein Pikettdienst aufrechtzuerhalten, der 30 Minuten nach der Alarmierung ausrücken kann.
Auf jedem Werkhof arbeiten mehrere Beschäftigte aus verschiedenen Berufen. Die in der Winterzeit anfallende zusätzliche Arbeitslast wird in der Regel im Sommer ausgeglichen. Um Spitzen in der Arbeitsbelastung aufzufangen, können die Werkhöfe auch externe Unternehmen einsetzen.
Die festen kosten im Winterdienst umfassen Aufwendungen für die Führung und Überwachung, Schulung sowie den Bereitschaftsdienst. Dazu kommen die variablen Kosten für die Bekämpfung der Winterglätte (Salzen) und für die Schneeräumung, die je nach Winter stark variieren können: Ein besonders kalter Winter führt zu höheren Kosten für die Bekämpfung von Eisglätte, dafür sind bei schwachen Niederschlägen die Einsatzzeiten der Schneepflüge kürzer. Fällt dagegen sehr viel Schnee, müssen die Schneepflüge länger fahren. Diese Faktoren beeinflussen auch die Kosten pro Stunde für die einzelnen Einsatzfahrzeuge.
An der Infrastruktur der Nationalstrassen hingegen verursachen längere Kälteperioden keine nennenswerten Probleme. Dagegen sind es Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt sowie Niederschläge, die für Schäden und Kostenaufwände sorgen.
50 Werkhöfe und Stützpunkte
Jeder der 50 Werkhöfe verfügt über 5 bis 15 Lastwagen mit Schneepflug (Breite 3,5-6 m), Streuer für 4 bis 6 m3 Salz und 2 m3 Sole. Für Streckenabschnitte, auf welchen der Schnee nicht an den Strassenrand geschoben werden kann, sind Schneeschleudern notwendig, um den Schnee auf Lastwagen zu laden.
Salzmengen
Zum Winteranfang sind die Lager voll: 64 000 Tonnen Salz und 1900 Tonnen Sole liegen zum Streuen bereit. Das Salz lagert in Hallen (bis zu 4000 Tonnen) oder Silos (100 bis 400 Tonnen pro Silo). Aus letzteren kann der Fahrer den Lastwagen schneller (2-3 Minuten) und ohne zusätzliches Personal mit Salz befüllen.
Im Allgemeinen schwankt die pro Durchgang gestreute Salzmenge je nach Wetter zwischen 5 und 20 g pro m2. Bis zum Ende der Wintersaison werden 8 bis 40 Tonnen Salz pro Strassenkilometer gestreut.
Neue Messsysteme mit Infrarot-Thermometer ermöglichen es, die Bodentemperatur in Echtzeit zu erfassen und die Salzmenge entsprechend einzustellen. Auf Autobahnen können so ohne Einbussen bei der Verkehrssicherheit 20 bis 25% Salz eingespart werden, was sowohl die Umwelt als auch das Budget für den Winterdienst schont.
Ohne zuverlässige und aktuelle Informationen über das Wetter kommt der Winterdienst nicht aus. Dazu stehen den Werkhöfen im Wesentlichen zwei Quellen zur Verfügung:
- MeteoSchweiz und andere Wetterdienste liefern den Werkhöfen 24 Stunden-Prognosen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind: diese Vorhersagen werden für mehr als 20 Zonen einzeln aufbereitet.
- Alle Werkhöfe können sich auf ein System von in die Fahrbahn eingelegten Detektoren stützen.
o Fahrbahndetektoren und Strassenwetterstationen liefern Daten über die folgenden Grössen: Lufttemperatur 2 Meter über dem Boden, Bodentemperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt, Gefriertemperatur, Niederschlag, Wind (Richtung und Stärke), Strassenzustand (trocken oder nass, Salzrückstände).
o Die örtlichen Stationen informieren über die Lufttemperatur 2 und 5 Meter über dem Boden, Feuchtigkeit und Taupunkt, Niederschlag (Art und Menge), Schneefallgrenze, Wind (Richtung und Stärke), Bewölkung und Zustand der Strassenoberfläche.
Es besteht keine gesetzliche Pflicht, das Auto im Winter mit Winterpneus auszurüsten. Die Empfehlung des Bundesamt für Strassen (ASTRA) ist jedoch klar: für die sichere Fahrt durch die kalte Jahreszeit ist eine wintertaugliche Bereifung unabdingbar. Denn Winterpneus bieten mehr Haftung auf rutschigen oder vereisten Strassen. Als Faustregel für den Einsatz von Winterpneus gilt «von O bis O – von Oktober bis Ostern».
Das Wetter hält sich nicht an ein Datum
Die Schweiz ist topographisch und klimatisch sehr kleinräumig – innerhalb weniger Dutzend Kilometer kann man vom mehrheitlich schneearmen, milden Mitteland in Bergregionen mit schneebedeckten Strassen fahren. Würde nun ein Winterreifenobligatorium beispielsweise auf den 1. November festgelegt, wäre das je nach Region oder aktuellen Wetterverhältnissen bereits zu spät. Kurz: ein datumabhängiges Winterreifenobligatorium würde sich schweizweit schwierig festlegen lassen.
Was zählt als Winterreifen?
Die gesetzliche Mindestprofiltiefe für Winter- sowie Sommerpneus beträgt 1,6 Millimeter. Sicherheitsrelevante Fahreigenschaften der Reifen wie bspw. die Haftung in Schnee und Matsch lassen jedoch bereits deutlich früher nach. Das ASTRA empfiehlt deshalb nur wintertaugliche Pneus mit einer Mindestprofiltiefe von 4 Millimetern zu montieren (bei Sommerpneus liegt die Empfehlung bei mind. 3 mm Profiltiefe). Nebst der Profiltiefe würden weiterführende gesetzliche Vorschriften zu den technischen Anforderungen an Winterpneus einem fast unüberschaubaren Regelwerk gleichkommen. Denn die Angebotspalette an «Winterreifen» ist breit: Es gibt Pneus, die hervorragende Eigenschaften auf salznassen Strassen bieten – andere sind klassische Schneereifen. Zudem gibt es Mischtypen und Ganzjahresreifen. Letztere gelten auch nur als Kompromisslösung, da sie Nachteile sowohl auf Schnee als auch bei warmen Temperaturen auf trockener Strasse bieten können. Wenn man sich nur auf schneebedeckten Strassen im Bündner Oberland bewegt, ist wohl ein Reifen mit guten Traktions- und Seitenführungseigenschaften auf Schnee die richtige Wahl. Wer tausende von Kilometern auf den salznassen Autobahnen des Mittellandes zurücklegt, wird ein anderes Produkt wählen. Die Anforderungen zur Beschreibung von zulässigen Reifentypen wären deshalb enorm hoch und kaum verhältnismässig.
Auch mal das Auto stehen lassen
So breit die Palette an Winterreifen ist, so eindeutig sind die gesetzlichen Vorschriften zur Fahrtauglichkeit: ein Fahrzeug darf nur in «betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zustand verkehren», so dass die Verkehrsregeln befolgt und die anderen Verkehrsteilnehmenden nicht gefährdet werden. Bei einem Unfall oder einer erheblichen Verkehrsbehinderung durch das Fahren mit Sommerpneus im Winter droht eine Busse oder sogar der Führerausweisentzug sowie eine Haftungsablehnung seitens Versicherung. Deshalb gilt, notfalls auch ein mit Winterreifen ausgerüstetes Auto stehen zu lassen, wenn die Strassenverhältnisse ein Weiterfahren nicht mehr sicher ermöglichen.
Gegen Glatteis kommen auch sogenannte Auftaumittel zum Einsatz. Es sind in der Regel Salzmischungen, welche die Bildung von Eisglätte auf der Fahrbahn auch bei kälteren Temperaturen vorbeugen.
Die Verwendung solcher mittel im Winterdienst muss mit Rücksicht auf die Umwelt erfolgen. Es gilt, Gewässer vor Beeinträchtigungen zu schützen.
Der Winterdienst auf Nationalstrassen erfolgt gemäss den Vorschriften des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Die im Kampf gegen Glatteis zugelassenen Mitteln sind in der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung aufgelistet.
Mehr dazu: Auftaumittel (BAFU)