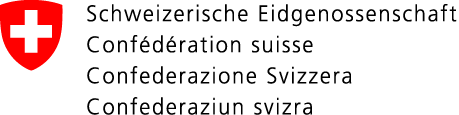Fahrzeuge, die eigenständig lenken, bremsen und beschleunigen: Automatisiertes Fahren verändert unsere Mobilität grundlegend. Es verspricht mehr Sicherheit, neue Zugänge zur Mobilität und effizientere Verkehrsflüsse. Erfahren Sie, welche Technologien dahinterstehen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten und wie sich die fünf Stufen der Automatisierung unterscheiden.

Ob selbstfahrende Shuttles, Robotaxis oder Lieferroboter... Pilotprojekte liefern wertvolle Praxiserfahrungen. Das ASTRA unterstützt diese Vorhaben, indem es für passende rechtliche Rahmenbedingungen sorgt und die Einführung praxisnah begleitet. Alle Organisationen, die Projekte im öffentlichen Strassenraum planen, sind eingeladen sich frühzeitig mit uns auszutauschen, damit wir gemeinsam die notwendigen Bewilligungen erarbeiten können:
Was ist automatisiertes Fahren?
Automatisiertes Fahren bezeichnet die Fähigkeit eines Fahrzeugs, bestimmte Fahraufgaben selbstständig zu übernehmen – ohne dass die fahrende Person ständig eingreifen muss. Das Fahrzeug lenkt, beschleunigt und bremst dabei unter definierten Bedingungen eigenständig.
Die Bandbreite reicht von einfachen Assistenzsystemen wie Spurhalte- oder Abstandsassistenten – diese zählen noch nicht als automatisiertes Fahren – bis hin zu hoch- und vollautomatisierten Systemen, die sämtliche Fahraufgaben übernehmen. In den höchsten Stufen ist kein menschliches Eingreifen mehr nötig: Das Fahrzeug bewältigt alle Verkehrssituationen eigenständig.
Die fünf Stufen der Automatisierung
Die Automatisierung wird gemäss der Klassifikation der Society of Automotive Engineers (SAE) in fünf Stufen unterteilt.
In Stufe 1 übernehmen Assistenzsysteme entweder die Längs- oder Querführung des Fahrzeugs. Die Kontrolle bleibt jedoch jederzeit vollständig beim Fahrer, der das System ständig überwachen muss.
In Stufe 2 erlaubt es dem Fahrzeug, sowohl Längs- als auch Querführung zu kombinieren jedoch bleibt der Fahrer weiterhin verantwortlich und muss jederzeit eingriffsbereit sein.
In Stufe 3 übernimmt das Fahrzeug alle Fahraufgaben innerhalb definierter Szenarien, wie zum Beispiel auf Autobahnen. Die Fahrerin und der Fahrer dürfen sich in dieser Phase zeitweise zurücklehnen, müssen jedoch bereit sein, auf Aufforderung hin die Kontrolle wieder zu übernehmen.
In Stufe 4 geht es noch einen Schritt weiter: Das Fahrzeug kann auf bestimmten Strecken, etwa in Parkhäusern oder speziell ausgewiesenen Zonen, vollständig selbstständig fahren. Selbst im Notfall ist kein menschliches Eingreifen mehr erforderlich, da das System in der Lage ist, eigenständig einen sicheren Zustand herzustellen.
In Stufe 5 ist keinerlei menschliches Eingreifen mehr vorgesehen.
Warum Automatisiertes Fahren?
Automatisiertes Fahren entwickelt sich zunehmend zu einem festen Bestandteil der Mobilität – angetrieben durch sicherheitstechnische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Faktoren.
Der wichtigste Treiber ist die Verkehrssicherheit: Die grosse Mehrheit der Unfälle ist auf menschliches Verhalten zurückzuführen – etwa Ablenkung, Müdigkeit oder Fehlverhalten. Automatisierte Systeme können hier deutlich zur Reduktion beitragen.
Ökonomisch und ökologisch bietet automatisiertes Fahren ebenfalls Potenzial: Weniger Unfälle bedeuten geringere Kosten. Gleichmässiges, vorausschauendes Fahren senkt zudem den Energieverbrauch – mit bis zu 30 Prozent weniger CO₂-Emissionen.
Auch gesellschaftlich eröffnet die Technologie neue Möglichkeiten. Menschen ohne Führerschein, mit Einschränkungen oder im höheren Alter erhalten neuen Zugang zur Mobilität. In ländlichen Regionen könnten automatisierte Shuttles Lücken im öffentlichen Verkehr schliessen.
Was benötigt es zum Automatisierten Fahren?
Technisch basiert automatisiertes Fahren auf dem Zusammenspiel von Sensoren, intelligenter Datenverarbeitung und einem klaren Rechtsrahmen. Sensoren wie Kameras, Radar oder LIDAR erfassen kontinuierlich die Umgebung und liefern die Basis für fahrdynamische Entscheidungen. Kritische Systeme sind redundant ausgelegt, um auch bei Ausfällen funktionsfähig zu bleiben.
Algorithmen der künstlichen Intelligenz verarbeiten diese Daten, erkennen Objekte und Verkehrssituationen und nutzen dafür auch hochpräzise Echtzeitkarten. Künftig soll eine Kommunikation mit Infrastruktur und anderen Verkehrsteilnehmenden dazukommen – etwa für Ampelphasen, Verkehrszeichen oder Störungsmeldungen. Die Infrastruktur ist entsprechend anzupassen.
Rechtlich erlaubt die Schweiz seit März 2025 verschiedene Anwendungsfälle des automatisierten Fahrens. Die Aufzeichnung relevanter Systemdaten im Fahrzeug sind dabei Pflicht. Ergänzend sorgen ethische Richtlinien sowie internationale Normen (z. B. ISO) für Klarheit – etwa zur Entscheidungsfindung in kritischen Situationen.
Forschung und Entwicklung
Wie verändern automatisierte Fahrzeuge unsere Strassen und unsere Gesellschaft? Das ASTRA forscht an zentralen Fragen rund um Infrastruktur, Regulierung und Datenaustausch – und schafft damit die Grundlage für eine sichere und zukunftsfähige Mobilität.
Ein aktueller Schwerpunkt der Forschung liegt auf Veränderungen der Anforderungen an die Strassen und die strassenseitige Infrastruktur durch automatisiertes Fahren. Aber auch Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft werden durch empirische Forschungen näher beleuchtet. Ebenso klären Forschungen auch bestehende rechtliche Lücken, zum Beispiel die Konkretisierung von Überwachungspflichten der Betreibenden von fahrerlosen Fahrzeugen. Das ASTRA hat momentan folgende Forschungen im Auftrag gegeben:
Automatisiertes Fahren. Auswirkungen auf die Strassenverkehrssicherheit. Schlussbericht vom 31. Mai 2018. Eine Studie von EBP Schweiz AG im Auftrag des Fonds für Verkehrssicherheit (FVS). (PDF, 907 kB, 05.07.2018)Gemäss Verkehrsunfallstatistik der Schweiz sind heute rund 90 Prozent der Strassenverkehrsunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen. Welches Sicherheitspotenzial das automatisierte Fahren birgt bzw. wie sich das automatisierte Fahren und die damit einhergehende Automation des Strassenverkehrs auf das Unfallgeschehen auswirken könnte, ist Gegenstand der vorliegenden Studie.
Chancen und Risiken des Einsatzes von Abstandshaltesystemen sowie des Platoonings von Strassenfahrzeugen - Machbarkeitsanalyse (PDF, 4 MB, 08.03.2018)Das Ziel der Studie ist das Erkennen möglicher Chancen und Risiken des Einsatzes von Abstandhaltesystemen, darunter des Platoonings (Kolonnenfahrten in geringen Abständen dank Vernetzung) in der Schweiz. Zudem sollen Grundlagen geschaffen werden, um allfällige Gesuche für Pilotprojekte im Truck Platooning zu bearbeiten und den Handlungsbedarf für das Schaffen technischer und verkehrlicher Voraussetzungen zu bestimmen.
Automatisiertes Fahren – Folgen und verkehrspolitische Auswirkungen (PDF, 713 kB, 21.12.2016)Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Leutenegger Oberholzer 14.4169 «Auto-Mobilität. Fahren ohne Fahrerin oder Fahrer. Verkehrspolitische Auswirkungen».
Rechtsgrundlagen – Rahmenbedingungen für automatisiertes Fahren
Klare Regeln für neue Technologien
Das automatisierte Fahren braucht einen verlässlichen rechtlichen Rahmen – national wie international. Die Schweiz schafft mit dem Strassenverkehrsgesetz, der Verordnung über das automatisierte Fahren (VAF) und weiteren Verordnungen die Voraussetzungen für sichere Innovation.
Die Artikel 25a bis 25g des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) bilden die Grundlage des nationalen Rechtsrahmens. Sie räumen dem Bundesrat die Kompetenz ein, bestimmte Anwendungsfälle zu regeln und so den Betrieb automatisierter Fahrzeuge der Stufen 3 und 4 zu erlauben. Ziel ist es, Innovation zu ermöglichen und zugleich Verkehrs- und Datensicherheit zu gewährleisten.
Die Verordnung über das automatisierte Fahren (VAF) konkretisiert drei Anwendungsfälle:
- Fahrzeuge mit Übernahmeaufforderung: Fahrzeuge, die auf Autobahnen automatisiert verkehren können, ohne dass die fahrzeugführende Person das System dauerhaft überwacht. Diese muss aber bereit bleiben, die Fahraufgabe wieder zu übernehmen.
- Automatisiertes Parkieren: Das System kann das Fahrzeug ohne anwesende fahrzeugführende Person innerhalb von vom Fliessverkehr abgetrennten und behördlich genehmigten Parkierungsfläche bewegen und es dort Einparkieren.
- Führerlose Fahrzeuge: Systeme, die führerlos auf vom Kanton genehmigten Strecken unterwegs sind. Sie müssen durch sogenannte Operatoren beaufsichtigt werden.
Um den verantwortlichen Behörden bei der Beurteilung von Strecken oder Parkierungsflächen zu helfen, stellt das ASTRA Weisungen bereit.
Wenn durch ein Automatisierungssystem ein Schaden verursacht wird, kommt die bewährte Halterhaftung zur Anwendung. Der Haftpflichtversicherung des Halters steht es bei einem möglichen Fehler des Systems frei, den Rückgriff auf den Hersteller des Systems zu prüfen.
Damit ein Automatisierungssystem zum Verkehr zugelassen werden kann, muss es typengenehmigt sein und daher den technischen Anforderungen der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) entsprechen. Diese definiert technischen Anforderungen und Sicherheitsstandards wie Bremsen, Beleuchtung und Unfalldatenspeicher (sog. „Blackbox“).
Weitere Informationen: Verordnung über das automatisierte Fahren
Automatisiertes Fahren ist ein globales Thema. Internationale Standards – etwa jene des UNECE World Forum for Harmonization (WP.29) oder der Europäischen Union – werden in der Schweiz über die Anhänge der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) ins nationale Recht übernommen. Dazu zählen unter anderem:
- UN-R157: Autobahnpilot
- UN-R160: Unfalldatenspeicher
- Durchführungsverordnung (EU) 2022/1426: automatisiertes Parkieren, führerlose Fahrzeuge
Auch völkerrechtliche Abkommen, insbesondere das Wiener Übereinkommen über den Strassenverkehr, tragen zur Harmonisierung der Verkehrsregeln bei und schaffen Voraussetzungen für den grenzüberschreitenden Einsatz automatisierter Systeme.
Ein flächendeckender Einsatz automatisierter Fahrzeuge setzt standardisierte technische Anforderungen und kompatible Infrastrukturen voraus. Der internationale Datenaustausch – etwa von Sensordaten oder KI-Modellen – verlangt zudem klare Datenschutzstandards und ethische Leitlinien.
Doch weltweit unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen erschweren die Skalierung. Um Rechtssicherheit und Vertrauen in die Technologie zu schaffen, braucht es ein koordiniertes, internationales Vorgehen.
Weitere Informationen zu den rechtlichen Grundlagen