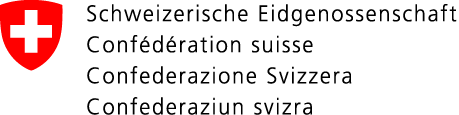Der Bund stellt verschiedene Publikationen zur Verfügung. Vollzugshilfen definieren Standards und dienen als Empfehlungen für die Vollzugsbehörden in Kantonen und Gemeinden.

Unter dem Begriff «Materialien» sind Grundlageinformationen, Beispielsammlungen und Studien zum Langsamverkehr zu finden.
Umfrage 2025 zur Umsetzung des Veloweggesetzes

Bis 2027 müssen Kantone und Gemeinden ein zusammenhängendes Velowegnetz planen – eines für den Alltags- und eines für den Freizeitverkehr. Eine aktuelle Zwischenbilanz des Bundesamts für Strassen (ASTRA) zeigt: Die Umsetzung des Veloweggesetzes verläuft schweizweit planmässig.
Vollzugshilfen Fussverkehr
Handbuch Schwachstellenanalyse und Massnahmenplanung Fussverkehr

Damit ein Fusswegnetz die Anforderungen an Sicherheit, Attraktivität, Netzdichte und Hindernisfreiheit erfüllen kann, muss es periodisch überprüft werden. Das vorliegende Handbuch Massnahmenplanung enthält praxisnahe Empfehlungen, wie Schwachstellen im Fusswegnetz analysiert, kategorisiert, priorisiert und hinsichtlich Behebung aufbereitet werden sollen. Exemplarisch werden Massnahmen im Längsverkehr, bei Querungsstellen, Flächen und Aufenthaltsbereichen sowie bei der Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr oder anderen Verkehrsmitteln aufgezeigt. Dabei geht es insbesondere um Dimensionierung, Standards und Qualität, um die Gestaltung des gesamten Strassenraums sowie um die Materialisierung von Oberflächen.
Das vorliegende Handbuch ergänzt das Handbuch Fusswegnetzplanung (ASTRA, Fussverkehr Schweiz, 2015), welches die Grundlagen für die Netzplanung und die rechtliche Sicherung beschreibt.
Handbuch Fusswegnetzplanung

Was nicht in Plänen festgehalten wird, wird nicht mitgeplant! Ein rechtlich gesicherter Fusswegnetzplan ist für Behörden, Planer und Grundeigentümer ein wichtiges Koordinationsinstrument. Damit Fusswege im Rahmen der Verkehrs- und Siedlungsplanung nicht vergessen werden und für Fussgängerinnen und Fussgänger attraktive und sichere Verbindungen sowie Aufenthaltsflächen zur Verfügung stehen, ist es wichtig, dass die Gemeinden ihre Fusswegnetze in offiziellen Plänen gemäss Fuss- und Wanderweggesetz (FWG) festhalten.
Das vorliegende Handbuch fasst das Know-how über Fusswegnetzplanung zusammen, ergänzt mit Beispielen und praxisgerechten Erläuterungen der rechtlichen Vorgaben, vorab zum FWG und der VSS Norm SN 640 070 Grundnorm Fussverkehr.
Ergänzend zum Handbuch stellt das ASTRA den Kantonen, Gemeinden und Datentreuhändern im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Datenerfassung ein Datenmodell Fusswegnetzplanung (DM14WalkwayplanningCH.ili) zur Verfügung. Das Modell ist darauf ausgelegt, dass die darin gespeicherten Daten kompatibel mit dem Minimalen Geodatenmodell Langsamverkehr MGDM LV sind.
Die Empfehlungen zur Datenerhebung sind als pdf downloadbar
Materialien Fussverkehr
VollzugdesBundesgesetzes über Fuss-und Wanderwege im Bereich Fussverkehr: Good Practice

Das Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) bildet die Grundlage für die Fusswegnetzplanungen. Eine erfolgreiche Umsetzung gelingt durch verbindliche Rechtsgrundlagen, klare Ziele und Standards sowie Fachstellen mit ausreichenden Ressourcen. Good-Practice Beispiele aus Kantonen und Gemeinden verdeutlichen, wie diese Elemente die Qualität und strategische Integration des Fussverkehrs sichern.
Vollzug des Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege (FWG) im Bereich Fussverkehr

Fussverkehr Schweiz hat im Auftrag des ASTRA im 2023 und 2024 in einer Umfrage bei den kantonalen Fachstellen Fussverkehr den Stand der Umsetzung des Fuss- und Wanderweggesetzes (FWG) im Bereich des Fussverkehrs erhoben. Der Bericht zeigt auf, dass noch nicht alle Kantone die Planung der Fusswegenetze in vollem Umfang umgesetzt haben. Viele Kantone haben die Umsetzung den Gemeinden übertragen, die ihre Aufgabe unterschiedlich wahrnehmen. Auch die Berücksichtigung des Fussverkehrs auf kantonaler Ebene erfolgt noch nicht in allen Kantonen in der nötigen Art und Weise.
Temporäre Gestaltungen - Neue Wege, die Stadt zu entdecken

Schweizweit haben in den letzten Jahren temporäre Gestaltungen im öffentlichen Strassenraum, die das Gehen und den Aufenthalt der Menschen zu Fuss fördern, an Bedeutung gewonnen. Auf Wochen, Monate oder Jahre befristete Interventionen im öffentlichen Raum ermöglichen der Bevölkerung ihre Stadt neu zu entdecken. Gleichzeitig wird mit partizipativen Prozessen gezielt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen. Welches sind die Erfahrungen und was sind die Herausforderungen? Anhand von Beispielen wird gezeigt, dass temporäre Gestaltungen die Möglichkeit bieten, im urbanen Raum zu experimentieren, sich diesen anzueignen und ihn gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
Begegnungszonen – Tendenzen und Herausforderungen nach 20 Jahren

Nach dem Test mit der Flanierzone in Burgdorf wurde vor 20 Jahren die Begegnungszone als neues Verkehrsregime eingeführt. Die veränderte Nutzung des Strassenraums mit Vortritt für die Menschen zu Fuss fand bald weitere Verbreitung.
Begegnungszonen erhöhen die Verkehrssicherheit und bieten die Möglichkeit zum angenehmen Aufenthalt im öffentlichen Raum und zur Förderung von nachbarschaftlichen Beziehungen.
Mit 20 Jahren Erfahrung stellen sich nun Fragen zur erweiterten Anwendung: Ist eine Begegnungszone möglich mit einer Velohauptroute, mit Busbetrieb, in einem ganzen Wohnquartier, in vielbefahrenen Strassenräumen?
Schritt für Schritt. Flâneur d’Or – Fussverkehrspreis Infrastruktur. Jubiläumsschrift zur zehnten Austragung
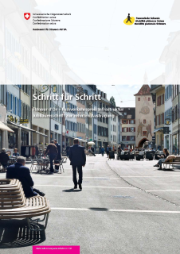
Seit mehr als 30 Jahren wird im 3-Jahresrhythmus ein Preis verliehen für vorbildliche Infrastrukturen in der Schweiz.
Die Publikation zeigt die Breite der ausgezeichneten Projekte: Umgestaltungen und neue Infrastrukturen für den Fussverkehr.
Einzelne Projekte haben sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt, die meisten haben auch nach Jahren unverändert ihren Vorbildcharakter beibehalten.
Fussverkehr und öffentlicher Raum – Wie private und öffentliche Übergänge gelingen

Öffentliche Räume umfassen Strassenräume und Verkehrsflächen. Diese Flächen sind häufig nicht nur im Besitz der «öffentlichen Hand». Wenn es gelingt, unabhängig von Parzellengrenzen alle Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer für eine Gestaltung von Fassade zu Fassade einzubeziehen, können angenehme Räume für Fussgängerinnen und Fussgänger geschaffen werden. Die sehr unterschiedlichen Projekte machen deutlich, dass dies meist Mehraufwand bedeutet und einen langen Atem erfordert. Die Beispiele zeigen aber auch, dass sich der Aufwand lohnt.
Wegleitsysteme Fussverkehr

Wie komme ich direkt in die Innenstadt? In welcher Richtung liegt der See? Wie lange dauert der Fussweg zum Spital? Ein Wegleitsystem für Fussgängerinnen und Fussgänger verschafft einen Überblick für Neuankömmlinge wie auch für Ortsansässige. Eine gute analoge, digitale oder interaktive Wegleitung macht den Fussverkehr attraktiv. Die Empfehlungen geben einen Überblick über realisierte Systeme und unterstützen Projektverantwortliche in Städten und Gemeinden bei der Planung und Umsetzung von Wegleitungen im Hinblick auf Verständlichkeit und Funktionalität.
Kantonale Fachstellen Fussverkehr – Aufgaben und Organisation
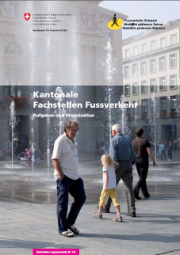
Die Planung und Umsetzung von Massnahmen zur Förderung des Fussverkehrs in Kantonen und Gemeinden ist komplex. Der Koordinationsaufwand ist beträchtlich und erfordert spezifisches Fachwissen.
Basierend auf einer Analyse in sechs Pilotkantonen werden in einem idealtypischen Musterpflichtenheft Empfehlungen im Hinblick auf Aufgaben und Organisationsformen einer kantonalen Fachstelle Fussverkehr gemäss Art. 13 FWG formuliert. Die Erkenntnisse sind sinngemäss auch auf städtische und kommunale Behörden übertragbar.
Vollzugshilfen Veloverkehr
Handbuch Velobahnen

Die Idee, den Veloverkehr durch hochwertige Velobahnen sicherer und flüssiger zu machen, ist eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre in der Mobilität. In vielen Ländern sind solche «Premium-Verbindungen» bereits weit verbreitet. Dank des Veloweggesetzes, das Velobahnen explizit erwähnt, planen auch in der Schweiz immer mehr Kantone und Gemeinden den Bau von solchen Veloanlagen. Das Handbuch des ASTRA und der Velokonferenz Schweiz erleichtert die Planung und Projektierung von Velobahnen und unterstützt einen möglichst einheitlichen Ausbaustandard.
Handbuch Veloverkehr in Kreuzungen

Ketten sind nur so stark wie ihr schwächstes Glied – dasselbe gilt auch für die Sicherheit und Attraktivität von Velorouten. Die schwächsten Glieder bei Velorouten sind fast immer die Kreuzungen; dort sind viele Velofahrende überfordert und dort ereignen sich die schwersten Unfälle. Damit Kreuzungen sicher befahren werden können, müssen diese für alle Verkehrsteilnehmenden rechtzeitig erkennbar sowie einfach und verständlich gestaltet sein. Dies kann umso besser gewährleistet werden, desto einheitlicher die Ausgestaltung der Kreuzungen ist. Das vorliegende Handbuch stellt standardisierte Knotenlösungen vor und leistet damit einen Beitrag zu einer sicheren und attraktiven Veloinfrastruktur.
Veloparkierung

Attraktive, sichere und zusammenhängende Wegnetze sind eine wichtige Voraussetzung für die vermehrte Nutzung des Velos. Von gleichrangiger Bedeutung für die Wahl des Velos als Verkehrsmittel ist aber auch eine qualitativ hochwertige Veloparkierung:
Was nützt der gute Veloweg, wenn es am Zielort nicht genügend bequem erreichbare Abstellmöglichkeiten hat, wo das Velo, geschützt vor Diebstahl und Witterung parkiert werden kann?
Und wer entscheidet sich für das Velo, wenn es zuerst über eine steile Treppe aus dem Keller getragen werden muss oder wenn es wiederholt am Bahnhof gestohlen oder beschädigt wurde?
Erst wenn auch die Parkierung den Anforderungen der Velofahrenden genügt, sind die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Erhöhung des Velo-Anteils am Gesamtverkehr erfüllt.
Eine hochwertige und attraktive Veloparkierung verlangt viele Mitwirkende: Behörden, Grundeigentümerinnen, Mieter, Architekten, Ingenieurinnen, Fachorganisationen und weitere. Ihnen soll das vorliegende Handbuch aufzeigen, welche Fragen und Aspekte bei Planung, Bau und Betrieb von Veloparkplätzen im öffentlichen und privaten Bereich besonders zu beachten sind.
Planung von Velorouten

Die Planung von attraktiven, sicheren und zusammenhängenden Veloverkehrsnetzen muss vielfältigen und komplexen Anforderungen genügen.
Deshalb definiert das ASTRA in diesem neuartigen Handbuch neun zentrale Qualitätsanforderungen an Velorouten. Das Handbuch beschreibt insbesondere die Bewertung und Umsetzung dieser Anforderungen im Planungsprozess, d. h. von der Netzplanung bis zur Projektierung. Zur Illustration dienen dabei konkrete Beispiele aus dem Alltags- und dem Freizeitverkehr.
Materialien Veloverkehr
Praxishilfe Zielgruppen im Veloland

In der Praxishilfe werden die vier Zielgruppen für das Veloland bzw. für Velofreizeit definiert. Diese Zielgruppen können sowohl von Planerinnen als auch von Produktmanagern im Tourismus angewendet werden. Die Anforderungen an Touren und Infrastruktur sind auf wenigen Seiten übersichtlich und kompakt aufgelistet. Die formulierten Kriterien basieren auf den langjährigen Erfahrungen von SchweizMobil und wirken «naheliegend», ja fast schon selbstverständlich – und sind damit praxistauglich.
Praxis Velowegnetzplanung

Die Praxishilfe richtet sich an Planungsbehörden und -fachleute. Sie formuliert Grundsätze zur Velowegnetzplanung, definiert Begriffe, schlägt eine sinnvolle Netzhierarchie sowohl für den Alltags- als auch den Freizeitverkehr vor und gibt Empfehlungen für das Vorgehen bei der Planung.
Velozählungen 2022: Starkes Wachstum in den Schweizer Agglomerationen

Nachdem der Veloverkehr 2020 aufgrund der Pandemie stark zugenommen hatte, war 2021 ein Rückgang zu verzeichnen. Die Daten von 2022 bestätigen den seit einigen Jahren beobachteten Wachstumstrend im Veloverkehr. Zwischen 2021 und 2022 verzeichneten mehr als 80% der Zählstellen einen Anstieg. Das Jahr 2020 wird nicht lange ein Rekordjahr bleiben: Die Werte für 2022 waren bereits bei zwei Dritteln der Zähler höher.
Verkehrserziehung in der Schule – Fokus Velo
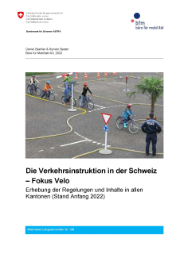
Die Studie gibt einen Überblick, wie in den Kantonen während der obligatorischen Schulzeit durch die Polizei Verkehrsprävention unterrichtet wird. Auf Grundlage dieses Bericht will sich das ASTRA in Zusammenarbeit mit dem Fonds für Verkehrssicherheit dafür einsetzen, dass die bestehenden Unterschiede beim Thema Veloverkehrserziehung reduziert werden und die Verkehrssicherheit bei den Schülerinnen und Schülern weiter erhöht wird.
Entflechtung der Veloführung in Kreuzungen – Studie

Das neue Veloweggesetz sieht vor, dass der Veloverkehr vermehrt getrennt vom motorisierten Verkehr und vom Fussverkehr geführt wird. In der Schweiz sind für das Velo verschiedene Formen der getrennten Führung auf der Strecke möglich (z.B. Radwege). Hingegen bieten das Gesetz und das Normenwerk noch kaum Werkzeuge für die Fortsetzung in Kreuzungen. Im Ausland, insbesondere auch in Ländern mit einer ausgeprägteren Velokultur, bestehen dazu etablierte Lösungen. Die vorliegende Studie zeigt auf, welche Lösungen im schweizerischen Kontext geeignet sein könnten. Die Studie stellt keine Umsetzungsempfehlung dar, sondern dient als Grundlage, um die darin dargestellten Lösungen vertieft zu untersuchen und allenfalls im Rahmen von Pilotversuchen zu testen.
Das Velo bei den Jugendlichen: Praxis, Image und Velofahrten – Eine Fallstudie in Yverdon-les-Bains

Kinder und Jugendliche in der französischsprachigen Schweiz fahren viel seltener mit dem Velo zur Schule als Gleichaltrige in der Deutschschweiz. Durchschnittlich sind es bei den 13–15-jährigen in der Westschweiz 4%, in der Deutschschweiz 34%.
Am Beispiel von Yverdon-les-Bains wurde nach Gründen für diesen geringen Veloanteil auf den Schulwegen gesucht.
Öffentliche Veloverleihsysteme in der Schweiz, Entwicklungen und Geschäftsmodelle – ein Praxisbericht

Der vorliegende Bericht ist eine Bestandsaufnahme aus den bisherigen Erfahrungen mit der Einführung, Gebrauch und Betrieb von Veloverleihsystemen in Schweizer Städten. Der Fokus liegt dabei auf den neuen Erkenntnissen aus diesen Projekten, mit Einschluss der sich stellenden rechtlichen Fragen.
Pilotversuch Velostrassen

In den fünf Städten Basel, Bern, Luzern, St.Gallen und Zürich wurden im 2016 bis 2017 Pilotversuche zu Velostrassen durchgeführt. Dabei wurden die Veränderungen im Vergleich mit dem Vorherzustand beobachtet. Der vorliegende Bericht diente als Grundlage für die Festlegung des weiteren Vorgehens bezüglich Velostrassen durch das ASTRA.
Velobahnen – Grundlagendokument

Velofahrerinnen und -fahrer wollen zügig und sicher ihre Ziele erreichen. Mit der zunehmenden Verwendung von E-Bikes werden vermehrt längere Distanzen mit dem Velo zurückgelegt. Diesen Bedürfnissen kann mit sogenannten Velobahnen entgegengekommen werden.
Im Ausland gibt es bereits gute Beispiele von Velobahnen. Zudem existieren Grundlagen und Planungsgrundsätze für die Planung solcher Verbindungen und Netze u. a. in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Das vorliegende Grundlagendokument ordnet diese Grundlagen in den schweizerischen Kontext ein und gibt erste Hinweise zu der Ausgestaltung der Velobahnen in der Schweiz. Das Dokument stützt sich unter anderem auf Studien und Konzepte von Kantonen und Regionen sowie Erfahrungen aus anderen Ländern. Es zeigt den heutigen Wissensstand und enthält Hinweise auf offene Fragen und Forschungsbedarf.
Velonutzung von Jugendlichen im Kanton Basel-Stadt Pilotstudie

Die Velonutzung von Kindern und Jugendlichen ist zwischen 1994 und 2005 zurückgegangen. Der Kanton BS hat deshalb mit verschiedenen Methoden nach den Ursachen für diesen Rückgang gesucht:
Abgesehen vom sehr gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, der in der Stadt Basel eine echte Konkurrenz zum Veloverkehr darstellt, spielt die Infrastruktur eine Schlüsselrolle für die Velonutzung. Die weiteren Gründe für oder gegen das Velofahren im Alltag oder in der Freizeit sind vielfältig: die Einstellung der Eltern oder von Gleichaltrigen hat grossen Einfluss auf die Velonutzung, ebenso der besuchte Schultyp. Der kulturelle Hintergrund der Familie oder eigene Erfahrungen – Unfälle, Diebstahl, Vandalismus – halten Jugendliche teilweise vom Velofahren ab. Andere wiederum geniessen das Velofahren als Ausdruck von Schnelligkeit, Flexibilität und Unabhängigkeit.
Velostationen: Empfehlungen für die Planung und Umsetzung
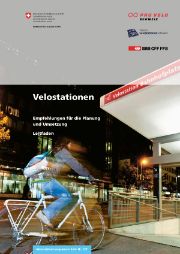
Diebstahl und Vandalismus, eine zunehmende Zahl an teuren Velos und E-Bikes und chaotische Abstellsituationen im öffentlichen Raum: Das Bedürfnis nach hochwertigen Veloabstellanlagen war nie grösser.
Velostationen bieten überwachte, gedeckte und zentral gelegene Abstellanlagen und decken dieses Bedürfnis optimal ab. In den nächsten Jahren werden in vielen Regionen der Schweiz neue Velostationen realisiert: bei Bahnhöfen, in Betrieben oder anderen publikumsintensiven Einrichtungen wie Einkaufszentren, Ausbildungsstätten, Ortszentren etc.
Dieser Leitfaden dient als Arbeitshilfe für die schrittweise Planung und Umsetzung einer Velostation. Er beantwortet wichtige Fragen aus der Praxis und stützt sich dabei auf konkrete Beispiele. Er will:
- Entscheidungshilfen bieten
- Prozessunterstützung geben
- Infrastruktur-Standards definieren
- Trägerschaftskonzepte und Betriebsmodelle darlegen
- Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen sowie
- auf wiederkehrende Aufgaben wie Kommunikation und Evaluation aufmerksam machen.
Velofachstellen Aufgaben und Organisation

Die Planung und Umsetzung von neuen Veloinfrastrukturen in Kantonen und Gemeinden ist komplex. Der Koordinationsaufwand ist beträchtlich und erfordert spezifisches Fachwissen.
Diese Publikation beleuchtete im 2012 die Aufgaben und Organisationsformen von Velofachstellen.
Veloverkehr im Einflussbereich von Hochleistungsstrassen
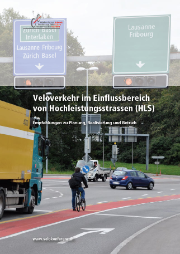
Anschlussbereiche von Hochleistungsstrassen weisen meist hohe Verkehrsbelastungen und Geschwindigkeiten auf. Zudem treffen hier Verkehrsarten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Bedürfnissen aufeinander. Die Planung und der Betrieb dieser Bereiche ist besonders anspruchsvoll,
denn es gilt, die sichere und komfortable Führung des Veloverkehrs ebenso zu beachten wie die Verkehrsmenge des motorisierten und die Ansprüche des öffentlichen Verkehrs.
Diese Publikation zeigt, wie der Veloverkehr in den Anschlussbereichen zu Strassen mit ausschliesslich Motorfahrzeugverkehr zu berücksichtigen und worauf bei deren Planung zu achten ist.
Wegweisung für Velos, Mountainbikes und fahrzeugähnliche Geräte

Die Fortbewegung per Velo, Mountainbike und mit fahrzeugähnlichen Geräten (FäG) benötigt attraktive, sichere und zusammenhängende Wegnetze. Dazu trägt auch eine gute Wegweisung bei. Die Grundsätze der Gestaltung und Dimensionierung der Wegweiser sind in der Norm SN 640829 festgelegt, welche beim VSS bestellt werden kann. Ergänzend zur Norm zeigt das vorliegende Handbuch anhand von Standardsituationen auf, wie die Velo-, Mountainbike- und FäG-Signale in der Praxis einzusetzen sind. Es richtet sich an Behörden und Fachpersonen, die mit Signalisationsaufgaben betraut sind. Eine gedruckte Version kann bei der Stiftung SchweizMobil bezogen werden (vgl. Link unten).
Screening Velobahnen entlang nationaler Verkehrsinfrastruktur
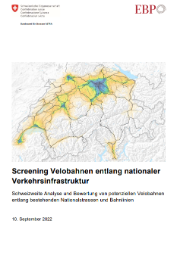
Die Studie zeigt auf, welche Abschnitte von Nationalstrassen und Bahnlinien die besten Voraussetzungen für ergänzende hochwertige Veloverbindungen, sogenannte Velobahnen, aufweisen. Die Studie stellt keine Strategie oder Umsetzungsempfehlung des Bundes dar, sondern dient als Grundlage, um die darin dargestellten Lösungen vertieft zu untersuchen und allenfalls im Rahmen ergänzender Studien in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu vertiefen.
Leitfaden Gefahrenprävention und Verantwortlichkeit auf Wanderwegen
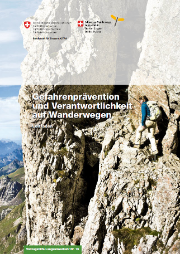
In der Schweiz werden die Grundsätze über Fuss- und Wanderwegnetze vom Bund festgelegt. Dazu gehört, dass Wanderwege möglichst gefahrlos begehbar sein sollen. In Anbetracht der Länge des Wanderwegnetzes von 65 000 Kilometern, einer von Gebirgs- und Hügelketten geprägten Topografie mit steilen Hängen und unwegsamen Geländepartien sowie der Popularität des Wanderns handelt es sich um eine anspruchsvolle Aufgabe. Diese ist in der Praxis immer wieder mit Unsicherheiten verbunden und wirft Fragen im Hinblick auf Haftungsrisiken auf.
Vor diesem Hintergrund bietet der vorliegende Leitfaden umfassend und praxisbezogen Hilfestellung bei der Gefahrenprävention auf Wanderwegen. Zugleich beantwortet er die Frage der Zuständigkeit und Verantwortlichkeit der verschiedenen Akteure, wie den Kantonen, Gemeinden, privaten Wanderweg-Fachorganisationen und ihren Mitarbeitenden.
Der Leitfaden ersetzt die bestehende Dokumentation «Haftung für Unfälle auf Wanderwegen», BUWAL, Nr. 266, 1996
Handbuch Bau und Unterhalt von Wanderwegen

Eine wichtige Voraussetzung für ein attraktives und sicheres Wanderwegnetz ist die hohe Qualität der Weganlagen selbst. Sie müssen fach- und situationsgerecht gebaut und unterhalten werden. Das vorliegende im 2025 überarbeitete Handbuch thematisiert die relevanten Bereiche des Wanderwegbaus und -unterhalts im Hinblick auf gegenwärtige und kommende Herausforderungen.
Das Handbuch mit den zahlreichen Abbildungen und Grafiken, Checklisten, weiterführenden Verweisen und Beispielen richtet sich an die für den Bau und Unterhalt von Wanderwegen zuständigen kommunalen und kantonalen Behörden, Fachorganisationen und Trägerschaften.
Handbuch Wanderwegnetzplanung
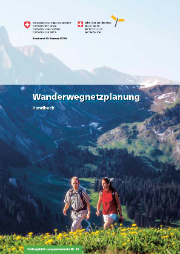
Das Schweizer Wanderwegnetz umfasst heute eine Gesamtlänge von über 60 000 km. Das Fuss- und Wanderweggesetz vom 4. Oktober 1985 verlangt von den Kantonen, die bestehenden und vorgesehenen Fuss- und Wanderwege in Plänen festzuhalten, diese periodisch zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen.
Die Hauptaufgabe der heutigen Wanderwegnetzplanung ist die Qualitätsförderung des bestehenden Netzes. Neuere kantonale Planungen zeigen eindrücklich, dass durch die Neuplanung von Routen der Abwechslungsreichtum der Linienführung gesteigert, der Hartbelagsanteil gesenkt, das Routenangebot überschaubarer gestaltet und die Signalisation optimiert werden konnten.
Das vorliegende Handbuch fasst das aktuelle Know-how zusammen und ergänzt es mit Beispielen und praxisgerechten Erläuterungen der gesetzlichen Vorgaben. Es soll alle an der Wanderwegnetzplanung Beteiligten bei ihren Aufgaben unterstützen.
Ersatzpflicht für Wanderwege

Das 1987 in Kraft gesetzte Fuss- und Wanderweggesetz bezweckt die Anlage und Erhaltung eines attraktiven, sicheren und zusammenhängenden Wanderwegnetzes mit naturnahen Wegoberflächen. Wird ein Wanderweg beeinträchtigt, beispielsweise durch Einbringen eines Hartbelags, muss das entsprechende Wegstück in den meisten Fällen gemäss Artikel 7 FWG durch einen Wanderweg ohne befestigte Wegoberfläche ersetzt werden. Gute Ersatzlösungen zu finden ist jedoch anspruchsvoll – alle tangierten Interessen müssen koordiniert werden. Die Vollzugshilfe veranschaulicht die anwendbaren Rechtsgrundlagen und stellt praxiserprobte Lösungen vor. Dies mit dem Ziel, den Vollzug eines zentralen Themas der Fuss- und Wanderweggesetzgebung zu stärken und zu vereinheitlichen. Sie richtet sich an Bauherren, Behörden, Interessensvertreter und Wanderwegverantwortliche.
Signalisation Wanderwege

Eine einheitliche, verständliche und aussagekräftige Signalisation ist ein wesentlicher Qualitätsfaktor für ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes Wanderwegnetz. Das anschaulich illustrierte Handbuch richtet sich an die für die Umsetzung verantwortlichen kantonalen und kommunalen Behörden, Fachorganisationen und Trägerschaften. Es bietet praktische Hilfen zu Planung, Montage, Kontrolle und Unterhalt der Wanderweg-Signalisation. Überdies behandelt es die zweckmässige Koordination mit der Signalisation anderer Langsamverkehrsformen (z.B. Velo, Mountainbike oder Skating).
Holzkonstruktionen im Wanderwegbau
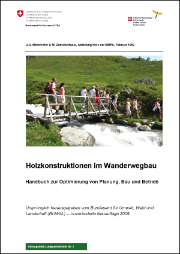
Dieses Handbuch enthält Empfehlungen, wie mit Holz attraktive, sichere und dauerhafte Wanderwegbauten erstellt werden können. Brücken, Stege, Treppen oder Hangsicherungen für einen Wanderweg müssen nicht nur sicher und wirtschaftlich sein. Sie sollen sich überdies möglichst gut in die Landschaft einpassen und eine positive Wirkung auf den Erlebniswert eines Weges haben. Diese Anforderungen werden mit Holz als Baumaterial in hohem Masse erfüllt – wenn es richtig gemacht wird. Die 1992 herausgegebene Vollzugshilfe ist auch heute noch aktuell. Es richtet sich in erster Linie an jene Stellen in kantonalen Verwaltungen, Gemeinden, Wanderwegfachorganisationen und im Baugewerbe, die sich mit Planung, Bau, Unterhalt und Sanierung von einfachen Bauwerken auseinandersetzen. Es enthält aber auch zahlreiche Hinweise und Empfehlungen, die bei anspruchsvolleren Konstruktionen anzuwenden sind.
Materialien Wandern und Mountainbiken
Haftung bei Unfällen auf Mountainbike-Weginfrastruktur

Mit der wachsenden Bedeutung der Mountainbike-Infrastruktur nehmen auch die haftungsrechtlichen Fragestellungen zu
In dieser Publikation werden die häufigsten Fragen zur Haftung bei Mountainbike-Unfällen geklärt, wie zum Beispiel:
- Wie weit reicht die Eigenverantwortung der Mountainbikenden – und ab wann haften Dritte?
- Welche Verantwortung trägt die Grundeigentümerschaft sowie Forst- und Landwirtschaftsbetriebe?
- Welche Pflichten treffen Akteure, die mit Planung, Bau oder Betrieb von MTB-Infrastrukturen betraut sind?
- Wie wirkt sich der rechtliche Rahmen je nach Wegtyp aus – sei es bei signalisierten Routen, Wald- und Feldwegen, gebauten Strecken oder wilden Trails?
Praxistest von Zählgeräten für die kombinierte Erfassung von Mountainbikes und Wandernden
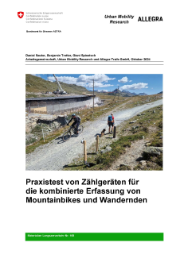
Der Bericht liefert wichtige Erkenntnisse zum Einsatz von kombinierten Zählgeräten für die Erfassung von Wandernden und Mountainbikenden auf gemeinsamen Wegen. Mittels eines konkreten Tests wurden drei Zählgeräte geprüft, um herauszufinden, wie einfach sie zu installieren sind, was bei der Standortwahl zu beachten ist, wie sich die Geräte im Betrieb verhalten, wie die Datenübermittlung funktioniert und wie genau die Geräte zählen, insbesondere, wie gut sie Wandernde und Mountainbikes voneinander unterscheiden können.
E-Mountainbike
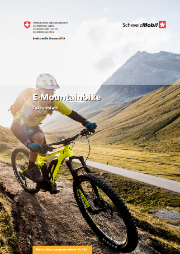
Velos mit elektrischer Tretunterstützung (sogenannte E-Bikes) haben im letzten Jahrzehnt eine grosse Verbreitung erlangt. Diese Entwicklung übertrug sich auch auf das Mountainbiken. Heute erfreuen sich motorisierte Mountainbikes, sogenannte E-Mountainbikes oder kurz E-MTB, einer wachsenden Beliebtheit. Die vorhandenen Grundlagen zum E-Mountainbiken aus dem In- und Ausland wurden ausgewertet und die Erkenntnisse in diesem Faktenblatt zusammengefasst.
Naturgefahren auf Wanderwegen und Mountainbikerouten
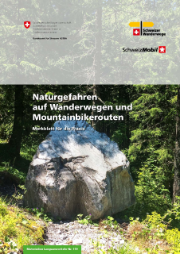
Das Merkblatt «Naturgefahren auf Wanderwegen und Mountainbikerouten» basiert inhaltlich auf dem Leitfaden «Gefahrenprävention und Verantwortlichkeit auf Wanderwegen» (ASTRA, Schweizer Wanderwege, 2017). Im Merkblatt werden die relevanten Naturgefahren kurz beschrieben und das jeweilige Vorgehen nach Wanderwegkategorie oder MTB Route schematisch erläutert.
Ergänzend zum Merkblatt steht eine Vorlage für das Begehungsprotokoll, das die Wegverantwortliche für die Erfassung von Ereignissen verwenden können, zur Verfügung. Das Merkblatt richtet sich insbesondere an Fachleute, die für die Sicherheit von Wanderwegen und Mountainbike Routen verantwortlich sind.
Zaundurchgänge für Wandernde und Mountainbikende – Praxishilfe
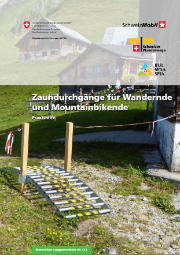
Geeignete Zaundurchgänge ermöglichen, dass der Weidebetrieb gewährleistet ist und die Wege, welche auch den Erholungssuchenden und Freizeitsportlern dienen, während der Weidezeit frei und sicher begeh- bzw. befahrbar bleiben. Eine optimale Gestaltung der Zaundurchgänge sorgt dafür, dass Nutztiere in der Umzäunung gehalten werden und stellt die Attraktivität der Wege und Routen für die Nutzenden sicher.
Die vorliegende Praxishilfe soll die Wahl von geeigneten Zaundurchgängen auf Wanderwegen sowie Mountainbikerouten und -pisten unter Berücksichtigung der Nutztierart, der Wegnutzung und der notwendigen, finanziellen und personellen Ressourcen vereinfachen.
Qualitätsziele Wanderwege Schweiz

Das Schweizer Wanderwegnetz geniesst über die Landesgrenzen hinweg einen guten Ruf.
Seine touristischen, verkehrs- und gesundheitspolitischen Funktionen kann es aber langfristig nur erfüllen, wenn es laufend weiterentwickelt und auf die aktuellen Ansprüche der Wandernden ausgerichtet wird. Die Qualitätsziele Wanderwege Schweiz gelten als Orientierungswerte für bestehende und zukünftige Wanderwege. Sie betreffen die wesentlichen Bereiche im Wanderwegwesen: Wanderwegnetzplanung, Bau und Unterhalt, Signalisation sowie Geoinformation.
Sperrung und Umleitung von Wanderwegen und Mountainbikerouten

Das Merkblatt befasst sich mit den signalisierten Wanderwegen und signalisierten Mountainbikerouten. Es richtet sich an die Praktiker und hält die essentiellen Informationen und Anwendungen fest, die bei Sperrungen und Umleitungen von Wanderwegen und Mountainbikerouten zu beachten sind. Mit dem vorliegenden Merkblatt soll der Zugang zu diesen Informationen für die Wegverantwortlichen in den Gemeinden erleichtert werden. Da die für die Wanderwege zuständigen Personen in der Regel auch für die MTB-Routen verantwortlich sind, wird im Merkblättern auch diesen Routen Rechnung getragen.
Wandern und Mountainbiken – Entscheidungshilfe zu Koexistenz und Entflechtung; Merkblatt für die Planung
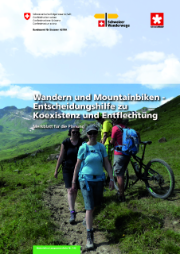
Wandern und Velofahren sind die beliebtesten Freizeitaktivitäten in der Schweiz und eine tragende Säule des Sommertourismus. Aber auch das Mountainbiken gewinnt an Bedeutung. Mit einer höheren Anzahl Nutzerinnen und Nutzer müssen die Mobilitätsformen jedoch aufeinander abgestimmt werden und die Herausforderungen an Planung und Betrieb von Wegen und Routen nehmen zu. Das vorliegende Merkblatt enthält Empfehlungen für die Planung, auf welchen Wegen ein Miteinander möglich ist oder eine Entflechtung angestrebt werden soll.
Winterwanderwege und Schneeschuhrouten Leitfaden für Planung, Signalisation, Betrieb und Information
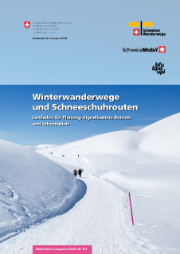
Winterwandern und Schneeschuhlaufen sind beliebte Outdoor-Aktivitäten mit zunehmender Bedeutung. Dabei sind signalisierte Wege und Routen eine attraktive Ergänzung des Angebots in Wintersportorten. Gleichzeitig werden die Besucher in sensiblen Gebieten im Sinne eines sanften Tourismus kanalisiert. Der vorliegende Leitfaden bietet praktische Hilfe bei Planung und Betrieb signalisierter Winterwanderwege und Schneeschuhrouten. Er möchte Behörden und Trägerschaften bei der Anwendung schweizweit harmonisierter Qualitätsstandards unterstützen, insbesondere im Hinblick auf eine einheitliche Signalisation im Kontext des Langsamverkehrs und des Best-of-Angebots von SchweizMobil. Der Leitfaden wird durch das Manual Winter von SchweizMobil (Bern 2019) ergänzt und ersetzt die bestehende BFU-Fachdokumentation 2.059 «Signalisierte Schneeschuhrouten» (Bern 2015).
Winterwanderwege und Schneeschuhrouten (2020) (PDF, 4 MB, 31.03.2020)Leitfaden für Planung, Signalisation, Betrieb und Information
Ökonomische Grundlagen der Wanderwege in der Schweiz
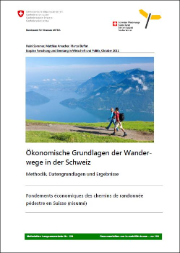
Das Wandern bildet eine wichtige Stütze des touristischen Grundangebots der Schweiz. Nur ungenaue Informationen bestanden bis anhin aber über die Kosten für die Aufrechterhaltung des schweizerischen Wanderwegnetzes. Unbekannt waren auch die Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte, die durch die Ausgaben der einheimischen und ausländischen Wandernden entstehen. Eine im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) und der nationalen Dachorganisation Schweizer Wanderwege (SWW) erstellte Studie schliesst diese Wissenslücken und legt konkrete Fakten vor. Fazit: Der Nutzen des Wanderns ist deutlich höher als seine Kosten. Es lohnt sich, in ein gut ausgebautes Wanderwegnetz zu investieren.
Statistik
Velozähldatenzentrale Schweiz - Auswertung 2024

Die Velozähldatenzentrale Schweiz sammelt im Auftrag des Bundesamtes für Strasse ASTRA alle verfügbaren Velozähldaten von permanenten Zählstellen in der Schweiz und wertet diese aus. Die Velozähldatenzentrale löst die bisherigen Publikationen «Velozähldatenzentrale SchweizMobil» und «Les comptages de vélos dans les agglomérations suisses» der OUVEMA ab.
Im Jahr 2024 wurden an 346 Zählstellen gesamthaft 89 Millionen Velos erhoben, die sich sehr ungleichmässig auf die Zählstellen verteilen. Gegenüber dem Vorjahr ist insgesamt eine Abnahme des Veloverkehrs um 1% feststellbar. Gemessen an der Anzahl Tage mit Regen war das vergangene Jahr das regenreichste Jahr seit 10 Jahren, was den Rückgang relativiert.
Auf dem Portal velo-ch.eco-counter.com sind die detaillierten Auswertungen für jede einzelne Zählstelle verfügbar.
Mobilität von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
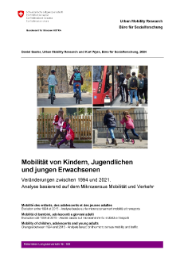
Die Mobilität von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich seit 1994 unterschiedlich entwickelt. 6- bis 12-Jährige gehen vorwiegend zu Fuss und fahren vermehrt mit dem Mini-Trottinett zur Schule. «Elterntaxis» sind nicht sehr häufig. Jugendliche sind oft multimodal unterwegs, ihre Velonutzung ist weiterhin stark zurückgegangen. Junge Erwachsene nehmen wegen der zunehmenden Distanzen zur Ausbildung häufiger den öffentlichen Verkehr, in der Freizeit fahren sie jedoch wieder etwas öfter Velo.
Wandern, Velofahren und Mountainbiken in der Schweiz 2020
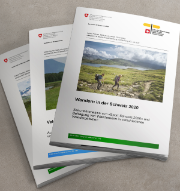
Wandern, Velofahren und Mountainbiken sind beliebte Freizeitsportarten in der Schweiz. Zusammen mit dem Verband Schweizer Wanderwege und der Stiftung SchweizMobil hat das Bundesamt für Strassen (ASTRA) drei Studien zu diesen Freizeitaktivitäten erstellt. Demnach ist die Popularität von Wandern, Velofahren und Mountainbiken in den letzten Jahren gestiegen und auch die wirtschaftliche Bedeutung ist gross. Die Ergebnisse stützen sich auf die nationale Studie «Sport Schweiz 2020» und auf zusätzliche, weitergehende Befragungen und bilden eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung und Qualitätsförderung des Langsamverkehrs-Angebots in der Schweiz. Sie sind in mobilitätsspezifischen Berichten zusammengefasst. Die Rohdaten der Tabellen und Graphiken sind als Excel-File ebenfalls downloadbar.
Mobilität von Kindern und Jugendlichen

Die Kinder und Jugendlichen in der Schweiz nutzen den öffentlichen Verkehr häufiger als vor zwanzig Jahren. Sie sind auch öfter zu Fuss unterwegs. Dafür fahren sie weniger Velo. Trottinettes, Kickboards und ähnliche Geräte erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit, leicht zugenommen haben auch die «Elterntaxis» für den Weg zur Schule. Dies zeigt eine Analyse der Bundesämter für Gesundheit (BAG), Sport (BASPO) und Strassen (ASTRA).
Velozählungen in den Schweizer Agglomerationen

Nach den boomenden Velozahlen im Jahr 2020 hat sich dieser Trend – mit einem verregneten Sommerhalbjahr - 2021 nicht im selben Mass fortgesetzt. Verglichen mit 2019, dem Jahr vor der Pandemie, verzeichnet die Mehrheit der Zählstellen dennoch keinen Rückgang. Über die letzten 5 Jahre betrachtet hält das Wachstum somit an. Ebenso steigt die Zahl der automatischen Zählstellen
weiterhin.
Allgemeine Vollzugshilfen und Materialien
Schwierigkeitsgerade Langsamverkehr LV für Freizeit und Tourismus

Die Angaben von Schwierigkeitsgraden im Langsamverkehr für Freizeit und Tourismus sollen nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Dies erleichtert den Vergleich zwischen verschiedenen Routen und erlaubt den Gästen, das für ihre Bedürfnisse passende Angebot zu finden und nutzen. Dieses Manual definiert die zur Vereinheitlichung notwendigen Massangaben. Sie sind breit abgestützt und bilden auch die Basis zur Beurteilung der nationalen, regionalen und lokalen Routen von SchweizMobil.
Langsamverkehr und Naherholung
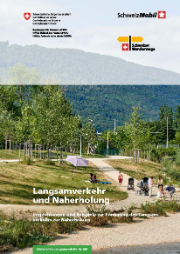
Empfehlungen und Beispiele zur Förderung des Langsamverkehrs zur Naherholung.
Die Kombination von Naherholung und Langsamverkehr ist von öffentlichem Interesse. Deshalb ist es wichtig, dass die zentrale Bedeutung von Naherholung und Langsamverkehr für die lokale Bevölkerung erkannt wird und entsprechende Angebote geschaffen oder gefördert werden.
Naherholung und Langsamverkehr sind wichtige Querschnittsthemen bei Planungsaufgaben wie der Siedlungs- und Verkehrsplanung sowie bei Agglomerationsprojekten, Landumlegungen oder Renaturierungsmassnahmen.
Diese Broschüre will mithelfen, die daraus entstehenden Synergien zu erkennen und zu nutzen. Sie will Bevölkerung, Politik, Behörden sowie Langsamverkehrs- und Planungsfachleute motivieren, Naherholung und Langsamverkehr bei raumwirksamen Aufgaben immer mitzudenken und von der damit verbundenen Verbesserung der örtlichen Lebensqualität zu profitieren.
Langsamverkehr entlang Gewässern

Naturnahe Erholungsräume, die in kurzer Zeit zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar sind, sind von öffentlichem Interesse und bieten Kantonen und Gemeinden beachtliche Standortvorteile. Gewässerräume sind dabei besonders wichtig.
Bis Ende 2090 werden Gewässerabschnitte im Umfang von rund 4000 Kilometern revitalisiert. Dazu kommen viele Massnahmen für den Hochwasserschutz. Diese Broschüre will mithelfen, die Chancen und Synergien zu nutzen, die durch eine Koordination der Interessen zwischen Renaturierungs- und Hochwasserschutzprojekten mit dem Langsamverkehr erzielt werden können. Sie stellt drei realisierte Projekte vor, die diese Herausforderung unter Einbezug aller Akteure erfolgreich gemeistert haben.
Die Geschichte des Langsamverkehrs in der Schweiz des 19. und 20. Jahrhunderts

Unser heutiges Verkehrssystem ist in vielfältiger Weise von seiner historischen Entwicklung geprägt, und viele der aktuellen Verkehrsfragen lassen sich nur im grösseren Zusammenhang der Verkehrsgeschichte erklären. Dennoch ist die Geschichte des Verkehrs in der Schweiz nur ansatzweise erforscht, und es fehlt eine Gesamtdarstellung, die alle Verkehrsformen - zu Land, zu Wasser und in der Luft - umfasst. Das Forschungsprogram «Verkehrsgeschichte Schweiz», initiiert und begleitet von «ViaStoria - Zentrum für Verkehrsgeschichte», will diese Lücke schliessen.
Die vorliegende Pilotstudie zum Langsamverkehr konzentriert sich darauf, das Forschungsfeld des nicht motorisierten Strassenverkehrs zu umreissen und die grossen, noch vorhandenen Wissenslücken über die Entwicklung des Langsamverkehrs vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart anzusprechen. Die Pilotstudie schafft damit die Voraussetzungen und Grundlagen für ein grösseres Forschungsprojekt, das die Geschichte des Langsamverkehrs im Rahmen der gesamten Verkehrsgeschichte der Schweiz bearbeiten soll, z.B. im Rahmen eines entsprechenden Projekts des Schweizerischen Nationalfonds.
Konzept Ausbildungsangebot Langsamverkehr

Für die Planung und Realisierung von attraktiven und sicheren Langsamverkehrsinfrastrukturen fehlt oft das nötige Fachwissen. Vor diesem Hintergrund möchte das im Auftrag des ASTRA vom Institut für Raumentwicklung der Hochschule Rapperswil IRAP entwickelte Konzept schweizerische Hochschulen und andere Bildungsinstitutionen für das Thema Langsamverkehr sensibilisieren. Im Rahmen von Modulen werden Vorschläge unterbreitet, wie Ausbildungsinhalte zum Langsamverkehr in die Aus- und Weiterbildung integriert werden können. Dies vor dem Hintergrund, eine nachhaltige Mobilität im Alltag und in der Freizeit zu fördern.
Bildungslandschaft Langsamverkehr Schweiz: Analyse und Empfehlungen für das weitere Vorgehen

In der Praxis, z.B. bei der Beurteilung von Agglomerationsprogrammen hat sich gezeigt, dass eine qualitativ hochstehende Planung, Projektierung und Umsetzung von attraktiven und sicheren Verkehrsanlagen für den Langsamverkehr noch nicht überall gewährleistet ist, da zu wenig Verkehrsfachleute mit Know-how im Bereich Langsamverkehr zur Verfügung stehen. Eine vom ASTRA in Auftrag gegebene Studie zeigt deutlich, dass das Bildungsangebot an den Schweizer Hochschulen zum Thema Langsamverkehr insgesamt noch ungenügend ist. Die Handlungsempfehlungen des Projektteams weisen Handlungsbedarf bei verschieden Akteuren - Bildungsinsitutionen, öffentlichen Verwaltungen und privaten Verbänden - aus.
Behinderten- und velogerechte Randabschlüsse – Bericht über die Testergebnisse

Randabschlüsse haben sowohl den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes als auch jenen des Veloverkehrs zu genügen. Als Mindestanforderung an ertastbare Randabschlüsse gilt seit 1988 ein vertikaler Absatz von 3 cm Höhe. Um eine bessere Überfahrbarkeit niedriger Randabschlüsse durch Rollstuhlfahrende zu ermöglichen, werden seit 2003 als Alternative schräge Randsteine mit 4 cm Höhe und 13–16 cm Breite (Neigung 25 %) zugelassen. Anhand von Tests wurde der Einsatz von schrägen Randsteinen evaluiert.
Baukosten der häufigsten Langsamverkehrsinfrastrukturen
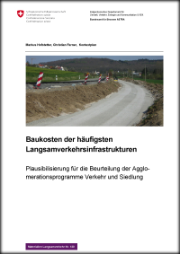
Wie viel kostet ein Fussgängerstreifen mit Mittelinsel? Mit welchen Baukosten ist bei der Markierung eines Radstreifens auf einer bestehenden Fahrbahn zu rechnen? Wie viel kosten 10 Veloabstellplätze: ungedeckt? gedeckt? abschliessbar? Ursprünglich für die Beurteilung der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung als verwaltungsinternes Hilfsmittel gedacht, soll das kleine Nachschlagewerk einem interessierten Publikum zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten der häufigsten Infrastrukturmassnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs lassen sich damit auch von Laien grob berechnen. Aufgeführt sind die Baukosten (Preisstand 2007 sowie Korrekturfaktor der Regionalkosten) ohne Landerwerbskosten.
Der Langsamverkehr in den Agglomerationsprogrammen

In Ergänzung zu den Vorgaben und Dokumenten zur Ausgestaltung der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE (vgl. Link unten) werden in dieser Arbeitshilfe die Besonderheiten des LV vertieft. Dazu gehört beispielsweise die zielgerichtete Evaluation der Schwachstellen, die Erarbeitung und Darstellung der LV-Massnahmen(-pakete) sowie die Sicherstellung der Umsetzungsverbindlichkeit.
Verfassungsgrundlagen des Langsamverkehrs

Das Rechtsgutachten zeigt, welche verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine Stärkung des LV auf Bundesebene bereits heute bestehen, und in welchen Bereichen entsprechende Lücken geschlossen werden könnten.
CO2-Potenzial des Langsamverkehrs
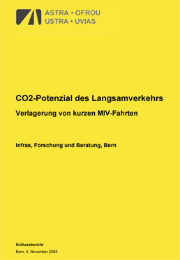
Die Fortbewegung mit den verschiedenen Formen des LV ist weitgehend CO2-neutral. Eine teilweise Verlagerung der vielen kurzen MIV-Fahrten stellt mittel- bis langfristig ein respektables CO2-Sparpotenzial dar (12% der Autofahrten sind nicht länger als 1 km, 34% nicht länger als 3 km, 50% nicht länger als 5 km).
CO2-Potenzial des Langsamverkehrs – Vermeidung von kurzen MIV-Fahrten (2005) (PDF, 1 MB, 28.11.2006)
Effizienz von Investitionen in den Langsamverkehr
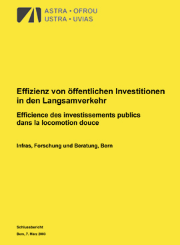
Investitionen in Infrastrukturen des LV weisen ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.
Grundlagen mit strategischer Bedeutung
Dokumente für die Entwicklung der Langsamverkehrs-Strategie auf Bundesebene.
Teilstrategie Langsamverkehr

Die Teilstrategie Langsamverkehr ist Bestandteil der Amtsstrategie. Die strategische Ausrichtung des ASTRA strebt für den Langsamverkehr eine Erhöhung des Verkehrsanteils sowie der Verkehrssicherheit an. Sie legt die Handlungsfelder und Massnahmen fest, mit denen die Ziele 2030 mit Bezug auf den Langsamverkehr erreicht werden sollen.
Leitbild Langsamverkehr (Entwurf 2002)

Der Vernehmlassungsentwurf des Leitbild LV gibt einen nach wie vor gültigen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder, Strategien und Umsetzungsmassnahmen im Kompetenzbereich des Bundes. Die vielen, sehr wichtigen LV-Fördermassnahmen, die in die Zuständigkeit der Kantone, Agglomerationen, Städte und Gemeinden sowie von Privaten fallen, sind nicht bzw. nur indirekt Gegenstand des Leitbildentwurfs.