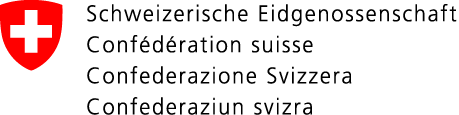Autos und Motorräder müssen bestimmte Lärmgrenzwerte einhalten, damit sie für den Strassenverkehr zugelassen werden können. Diese Grenzwerte sind im Schweizer Strassenverkehrsrecht festgehalten (Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge VTS). Aufgrund der bilateralen Verträge sind sie mit den europäischen Vorschriften identisch.

Diese Vorschriften werden laufend weiterentwickelt, mit dem Ziel, die Fahrzeuge leiser zu machen. Dabei ist zu beachten, dass ein Fahrzeug während seiner ganzen Verwendungszeit die Grenzwerte einhalten muss, die es zum Zeitpunkt seiner Zulassung erfüllen musste. Das bedeutet, dass die heute für neue Fahrzeuge geltenden Vorschriften nicht rückwirkend für ältere Fahrzeuge angewendet werden.
Nebst den fahrzeugtechnischen Vorschriften sollen Verkehrsregeln betreffend die korrekte Verwendung der Fahrzeuge zur Lärmminderung beitragen. Das Strassenverkehrsrecht verlangt, dass Fahrerinnen und Fahrer von Motorfahrzeugen jede vermeidbare Lärmbelästigung unterlassen. Untersagt sind zum Beispiel hohe Drehzahlen des Motors im Leerlauf, oder beim Fahren in niedrigen Gängen wie auch zu schnelles Beschleunigen beim Anfahren. Auch fortgesetztes, unnötiges Herumfahren in Ortschaften ist untersagt. Wer mit seinem Fahrzeug unnötigen Lärm erzeugt, kann verzeigt werden.
Unnötigen Lärm verursachen auch illegal abgeänderte Fahrzeuge. Dies ist ebenfalls strafbar. Die kantonalen Behörden führen regelmässig Kontrollen auf den Strassen durch, um solche Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu lauten Fahrzeugen
Die FAQs beziehen sich auf Personenwagen (Fahrzeuge der EU-Klasse M1) und Motorräder (Fahrzeuge der EU-Klasse L3). Wo nicht differenziert wird, gelten die Antworten für beide Fahrzeugklassen.
Besonders auffallend sind Motorräder, Sportwagen und illegal abgeänderte Fahrzeuge.
Nebst den fahrzeugseitigen Vorschriften kennt das Schweizer Recht auch Vorschriften, welche die korrekte Verwendung der Fahrzeuge betreffen. Das Strassenverkehrsrecht verlangt, dass Fahrerinnen und Fahrer von Motorfahrzeugen jede vermeidbare Lärmbelästigung zu unterlassen haben. Untersagt sind zum Beispiel hohe Drehzahlen des Motors im Leerlauf, beim Fahren in niedrigen Gängen oder zu schnelles Beschleunigen des Fahrzeugs beim Anfahren. Auch fortgesetztes, unnötiges Herumfahren in Ortschaften ist untersagt. Wer mit seinem Fahrzeug unnötigen Lärm erzeugt, kann verzeigt werden. Auch Personen, die ihre Fahrzeuge illegal abändern, werden bestraft. Die entsprechenden Vorschriften finden sich im Strassenverkehrsgesetz (Art. 42 Abs. 1 SVG; SR 741.01), in der Verkehrsregelnverordnung (Art. 33 VRV; SR 741.11) und der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge. (Art. 53 Abs. 4 und Art. 219 Abs. 2 VTS; SR 741.41). Die Kontrolle und Durchsetzung der geltenden Vorschriften liegen in der Zuständigkeit der Kantone.
Damit Fahrzeuge auf öffentlichen Strassen zugelassen werden können, müssen unter anderem Lärm-Grenzwerte eingehalten werden. Grenzwerte und Prüfverfahren sind in der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) festgehalten. Sie stimmen mit den EU-weit geltenden Vorschriften überein, an welche die Schweiz durch die bilateralen Verträge mit der EU gebunden ist.
Damit ein Personenwagen oder Motorrad zum Verkehr zugelassen werden kann, braucht das Fahrzeug eine (EU-)Typengenehmigung (TG), ein CoC (Certificate of Conformity) oder es wird einzeln geprüft und zugelassen. Die TG oder das CoC bescheinigt, dass das Fahrzeug die Geräuschvorschriften erfüllt. Massgebend für die Zulassung, die Erlangung der TG oder des CoC ist die Vorbeifahrtmessung. Diese erfolgt unter streng definierten Bedingungen und kann nicht vor Ort, sondern nur auf Prüfanlagen vorgenommen werden. Nach den aktuell geltenden Vorschriften dürfen keine Vorrichtungen (z.B. Klappensysteme) mehr eingesetzt werden, wenn sie lediglich dazu dienen, das Fahrzeug lauter zu machen.
Zusätzlich zu den Grenzwerten sind unnötig lärmsteigernde Eingriffe generell untersagt. Auch zu Anbauteilen wie umgebauten Auspuffen gibt es Bestimmungen. So müssen etwa Ersatz-Schalldämpfer über eine Genehmigung verfügen und ebenso wirksam wie die ursprünglich zugelassenen sein (Art. 53 VTS; SR 741.41). Ob ein Fahrzeug den Vorgaben entspricht, wird unter anderem im Rahmen der periodischen Motorfahrzeugkontrolle geprüft.
Ob ein Fahrzeuge als laut wahrgenommen wird oder nicht, hängt stark vom persönlichen Empfinden ab. Hinzu kommt, dass durch das Fahrverhalten stark gesteuert werden kann, ob ein Fahrzeug laut oder leise ist.
Es gibt Vorschriften zum Prüfverfahren und es gelten bestimmte Lärmgrenzwerte. Diese Vorschriften sind in zahlreichen UN-Reglementen und EU-Vorschriften festgehalten. Nur wenn diese Vorschriften eingehalten werden, kann ein Fahrzeug eine Typengenehmigung (resp. CoC oder eine Einzelzulassung) erlangen. Die Schweiz ist aufgrund internationaler Verträgen verpflichtet, Fahrzeuge mit einem entsprechenden Nachweis (EU-Genehmigung oder CoC) ohne weitere Prüfung zuzulassen. Egal, ob die Fahrzeuge als zu «laut» wahrgenommen werden oder nicht.
Weiter können insbesondere Motorräder auf der Strasse mehr Lärm machen als im Prüfverfahren. Ein Fahrzeug, welches im Prüfverfahren die Vorschriften einhält, kann ausserhalb des Prüfbereichs wesentlich lauter sein. So deckt etwa das aktuell geltende Prüfverfahren für Motorräder lediglich den Geschwindigkeitsbereich von 20 km/h bis 80km/h ab.
Die Geräuschvorschriften wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt und verschärft. Strengere Vorschriften gelten nicht rückwirkend, für ältere Fahrzeuge gelten also noch «mildere» Grenzwerte und Messvorschriften. Die Anforderungen an den Prüfzyklus - ein vorgegebenes Prüfprogramm - wurden 2016 verschärft und die Zulassung lauter elektronischer Auspuffklappen erschwert. Schlupflöcher wurden geschlossen. Auspuffklappen sind heute verboten, wenn sie lediglich dazu dienen, das Fahrzeug lauter zu machen. Die Vorschriften für die neuen Typengenehmigungen wurden in der Schweiz 2016 im Gleichschritt mit der EU eingeführt. Die nach den heute geltenden Vorschriften genehmigten Fahrzeuge sind über einen grösseren Geschwindigkeitsbereich hinweg leiser geworden.
Ja. Die internationalen Rechtserlasse sehen ab 2024 für neue Fahrzeugtypen der Klasse M1 (Personenwagen) eine Absenkung des Grenzwertes um 2 dB(A) vor. Für neue Fahrzeugtypen der Klasse L3 (Motorräder) sollen ab 2023 die Bedingungen zur Erfüllung des Prüfprozesses (Additional Sound Emission Provisions, kurz ASEP) verschärft werden: U.a. soll der Messbereich für Motorräder erweitert (von 20 km/h bis 80 km/h auf 10 km/h bis 100 km/h) werden. Auch sollen neu Zufallsmesspunkte (beliebige Geschwindigkeit innerhalb des Messbereichs, beliebige Beschleunigung, beliebiger Zeitpunkt, etc.) durch die Prüfstelle bestimmt und geprüft werden können.
Nein. Neue, verschärfte Geräuschvorschriften gelten nicht rückwirkend für bereits in Verkehr stehende Fahrzeuge. Alte, laute Fahrzeuge werden am Ende ihres Lebenszyklus aus dem Strassenverkehr verschwinden.
Es sind jeweils die Vorschriften (z.B. Grenzwerte, Messbedingungen) anwendbar, die beim Import (Datum Zollstempel) in der Schweiz gelten. Das Fahrzeug kann also danach zu einem beliebigen Zeitpunkt so zugelassen werden, wie es importiert wurde.
Das Verfahren für die Erteilung der Typengenehmigung, des CoC, bzw. für die Verkehrszulassung schreibt eine beschleunigte Vorbeifahrt vor. Hier wird unter klar festgelegten Bedingungen eine Fahrsituation simuliert. Nur für diese Vorbeifahrtmessung gibt es einen verbindlichen Grenzwert. Derzeit liegen die Grenzwerte für Personenwagen bei 75 dB(A) und bei Motorrädern mit einem Hubraum bis 80 cm3 bei 75 dB(A); bis 175 cm3 bei 77 dB(A) und über 175 cm3 bei 80 dB(A).
Die je nach Fahrzeug anzuwendenden Messverfahren sind in umfangreichen UN-Reglementen und EU-Verordnungen festgelegt. Die Schweizer Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) verweist in ihren Anhängen auf die jeweilig anzuwenden Rechtserlasse.
Klappen können Teil einer Technologie sein. Hersteller hatten unter den alten Vorschriften Schlupflöcher ausgenützt, um ihre Fahrzeuge für den Prüfzyklus zu optimieren. Es wurden Auspuffklappensteuerungen verbaut, welche beim Messzyklus geschlossen wurden und damit dem Zweck dienten, die Anforderungen der Vorbeifahrtsmessung zu erfüllen. Die «neuen», heute geltenden Vorschriften verbieten genau solche Systeme, wenn sie nur dazu dienen, mehr Lärm zu erzeugen.
Ja. Die aktuell geltenden Vorschriften schliessen nicht aus, dass der Fahrzeughersteller verschiedene Fahrprogramme (wie «Sport», «Komfort» usw.) vorsieht, die auch das Geräuschverhalten des Fahrzeugs beeinflussen, beispielsweise über Auspuffklappen. Voraussetzung ist aber, dass diese Klappen nicht nur im Prüfverfahren, sondern auch im normalen Verkehr wirksam sind und dass das Fahrzeug die massgebenden Vorschriften in allen wählbaren Fahrprogrammen (Comfort, Sport, etc.) einhält.
Grundsätzlich ja, sofern es sich um vorschriftskonforme Klappensysteme handelt. Die Verkehrsregeln sind allerdings zu beachten. Diese untersagen die unnötige Lärmbelästigung, insbesondere in Wohn- und Erholungsgebieten und nachts.
Bei einer Polizeikontrolle auf der Strasse wird in der Regel eine Nahfeldmessung (Standmessung) durchgeführt. Diese dient lediglich zur Vorabklärung. Bei dieser Messung wird mit einem Mikrofon nahe am Auspuffendrohr gemessen (Distanz 0,5 Meter). Der gemessene Wert (Standgeräusch) wird mit dem Referenzwert (Standgeräuschwert) in der Typengenehmigung, der EU-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC/Certificate of conformity) oder im Fahrzeugausweis verglichen. Werden Abweichungen nach oben festgestellt, ist dies ein Indiz dafür, dass das Fahrzeug zu laut ist. Da die Polizei vor Ort bei einer Kontrolle nicht in der Lage ist, die messtechnisch anspruchsvolle Vorbeifahrtsmessung durchzuführen, wird der Fahrzeughalter zur Nachkontrolle auf das zuständige Strassenverkehrsamt aufgeboten. Dieses kann die Messung durchführen oder durch eine autorisierte Prüfstelle veranlassen.